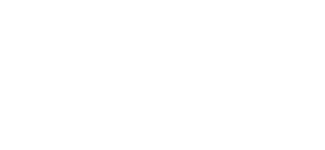Im profanen Bereich war im römischen Reich der Patron vor Gericht Vertreter derjenigen Menschen, die von ihm abhängig waren.
Zwischen dem Patron und seinen Schutzbefohlenen bestand ein wechselseitiges Treueverhältnis.
Im 3./4. Jh. wurde diese Vorstellung im Christentum zunächst auf Märtyrer, dann auf alle Heilige und insbesondere auf Maria übertragen.
Vor allem im Osten wurde die Gottesmutter als Beschützerin der Christenheit angerufen.
Im kaiserlichen Konstantinopel, wo Kleid und Schleier als Marienreliquien verehrt wurden, schrieb man die Abwehr feindlicher Belagerungen dem Schutz der Gottesmutter zu.
Nach einer Legende rettete Maria mit ihrem Umhang einen jüdischen Knaben vor dem sicheren Feuertod.
Diese Legende macht das Motiv des Schutzmantels als sinnenfälliges Zeichen des Patronats Mariens auch im Westen populär.
Über die praktische Bedeutung als Kleidungsstück hinaus hat der Mantel in vielen Kulturkreisen seit jeher symbolische Bedeutung.
Bei Königen und Königinnen ist er Zeichen der Herrschaft und Würde. Außerdem symbolisiert er Schutz und Geborgenheit.
Beide Bedeutungen vereinen sich im Motiv der Schutzmantelmadonna, das seit dem 13./14. Jh. in der abendländischen Kunst weit verbreitet ist.
Zur Verbreitung des Schutzmantelmotivs in der Marienverehrung trug auch ein mittelalterlicher Rechtsbrauch bei: Die Bedeckung mit dem Mantel symbolisierte bei der Adoption von Kindern das neu entstandene Schutzverhältnis.
Außerdem konnten schwangere Frauen sowie Jungfrauen Verfolgten, die unter ihrem Mantel Schutz suchten, Asyl gewähren: Unter dem Schutzmantel erging Gnade vor Recht.
Diese Bräuche wurden auf die Gottesmutter übertragen, zumal sich die Gläubigen in Auslegung des Johannesevangeliums als angenommene Kinder Maria verstehen konnten:
Der namentlich nicht genannte Jünger, dem Christus unter dem Kreuz Maria als Mutter anvertraut (Joh 19, 26f), vertritt als Idealtypus ("der Jünger, den Jesus liebte") die gesamte Christenheit.
Ein "Instanzenweg" der Fürbitte - wir wenden uns bittend an Maria, sie tritt für uns bei ihrem Sohne ein - mag uns heute fremd und vielleicht auch theologisch fragwürdig erscheinen:
Können wir uns im Gebet nicht unmittelbar an Gott wenden? Ist nicht Jesus Christus der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch (vgl. 1 Tim 2,5-6)?
Das 2. Vatikanische Konzil erklärt dazu in seiner Konstitution Lumen Gentium (Kap. VIII):
In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie (= Maria) Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen.
Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen.
Das aber ist so zu verstehen, dass es der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen Mittlers, nichts abträgt und nichts hinzufügt.
Die Kirche ist - modern formuliert - eine Solidargemeinschaft, die nicht mit dem Tod des Einzelnen endet.
Sie besteht aus dem "pilgernden Gottesvolk" auf Erden und denen, die ihren irdischen Weg bereits beendet haben.
Wie wir in jeder Eucharistiefeier füreinander und für die Verstorbenen beten, so hoffen wir auf die Fürsprache der Heiligen und insbesondere der Gottesmutter,
die ihren Lebensweg vollendet haben und in die Herrlichkeit Gottes eingegangen sind.